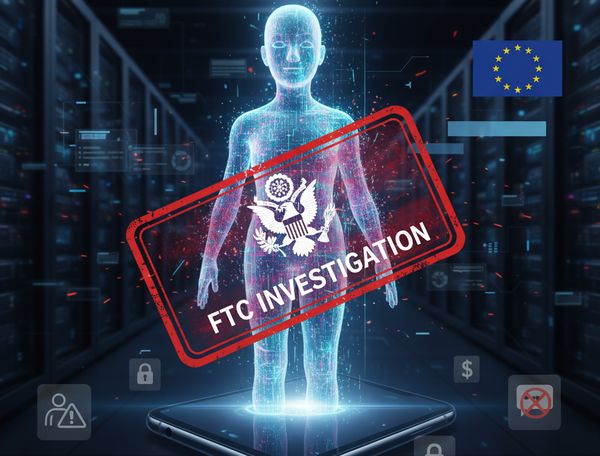Russland treibt den Aufbau eines eigenen Satelliten-Internets mit Nachdruck voran. Roskosmos-Chef Dmitry Bakanov sprach in einem TV-Interview von „hohem Tempo“ beim Entwicklungspfad hin zu einer nationalen Alternative zu Elon Musks Starlink. Hintergrund ist der strategische Wunsch, unabhängiger von ausländischer Konnektivität zu werden und gleichzeitig den innovationsmüden Raumfahrtsektor neu aufzustellen. Starlink dominiert mit der weltweit größten Breitband-Konstellation im niedrigen Erdorbit (LEO) und gilt als Referenz für schnelle, flächendeckende Internetversorgung – von entlegenen Regionen bis hin zu Krisen- und Kriegsgebieten. Reuters bestätigt die neue russische Stoßrichtung und ordnet sie in den Kontext eines Generationswechsels bei Roskosmos ein: Der 39-jährige Bakanov will „Trägheit“ ablegen, Talente anziehen und Prioritäten neu setzen.
Industriebasis: Bureau 1440 als Kernlieferant
Operativ stützt sich das Projekt maßgeblich auf Bureau 1440. Das Unternehmen entwickelt eine LEO-Konstellation mit Laser-Inter-Satelliten-Links, um Daten orbital weiterzureichen und so den Bedarf an dichtem Bodengateway-Netz drastisch zu reduzieren. Auf der englischsprachigen Unternehmensseite werden laserbasierte Relaisstrecken, eigene Nutzerterminals für stationäre und mobile Plattformen (Fahrzeuge, Schiffe, Luftfahrt) sowie der Aufbau einer Fertigungsbasis hervorgehoben. Die russische Presse und internationale Fachmedien nennen Bureau 1440 schon länger als Designzentrum für Prototypen und Seriensatelliten; die Rassvet-Testplattformen gelten als technologische Vorläufer, die seit 2024/2025 dokumentiert sind. Aviation Week berichtet zudem, dass Bureau 1440 als Erstkunde für die neue Trägerrakete Soyuz-5 in Frage kommt – ein Puzzleteil für künftige Bündelstarts, die für LEO-Konstellationen entscheidend sind.
Zeitplan, Meilensteine und Umfang
Bakanov verweist auf bereits „geprüfte Testvehikel im Orbit“ und Anpassungen an Produktionssatelliten. Konkrete Batch-Größen sind offiziell spärlich, doch in früheren Aussagen war von einem ersten „Schwung“ zum Jahresende die Rede, mit einer Startlogik „wie bei Starlink“. Parallel zirkulieren Zielmarken für die Flottengröße, die sich über die Jahre verfeinern dürften. AeroTime skizzierte einmal einen Pfad in Richtung mehrerer Hundert Einheiten bis Anfang der 2030er Jahre, mit schrittweiser Verdichtung und Ersatzstarts. Unabhängig von exakten Zahlen ist klar: Der Maßstab von SpaceX, mit mehreren Tausend aktiven LEO-Satelliten und hoher Startkadenz, setzt die Benchmark. Um dorthin aufzuschließen, braucht Russland mehr als eine technische Minimaldemonstration – es braucht stabile Produktionslinien, verlässliche Träger, eine funktionierende Lieferkette und skalierbare Nutzerterminals.
Technik: Laser-Links, Terminals und Orbitarchitektur
Die geplante Architektur folgt dem Erfolgsrezept moderner LEO-Netze: kleine bis mittelgroße Satelliten mit elektrischer Energieversorgung und Phased-Array-Antennen, ergänzt um Laser-Verbindungen zwischen den Raumfahrzeugen. Der Vorteil: Verkehr kann orbital umgeleitet werden, Latenzen sinken, und Bodenstationen müssen nicht in jedem Zielgebiet stehen. Bureau 1440 betont die eigene Entwicklung der Laserterminals und stellt Nutzerhardware in Aussicht, die sowohl stationär (ländliche Räume, Offshore-Anlagen) als auch mobil (Straße, See, Luftfahrt) integriert werden kann. Die Rassvet-Serie, in internationalen Registern und Fachseiten dokumentiert, dient als Baukasten für spätere Serienstufen. Solche Testplattformen sind üblich, um Linkbudgets, Terminaldesign, Thermik, Stromversorgung und Software-On-Orbit zu validieren, bevor die Massenfertigung startet.
Einordnung im Programm „Sfera“
Das Breitbandprojekt ist in den größeren russischen Satcom-Masterplan „Sfera“ eingebettet. Sfera fasst unterschiedliche Subprogramme zusammen – von mittelhochbahnigen Breitbandsatelliten (Skif) über IoT-Konstellationen (Marafon) bis hin zu TV/Kommunikationsplattformen. Damit existiert eine staatliche Programmschiene, die Frequenzen, Budgets und Industriekonsortien bündelt. Für die Breitband-Komponente lassen sich aus den vergangenen Jahren zwei Linien ablesen: erstens die Sicherung von Spektrum und Technologiepfaden durch frühe Demonstratoren; zweitens der Versuch, binnen weniger Jahre eine Start- und Produktionskadenz aufzubauen, die über Prototypen hinausgeht. Der Hebel für Erfolg liegt dabei weniger im ersten Start als in der Fähigkeit, Starts regelhaft zu wiederholen und die Konstellation planmäßig zu verdichten.
Herausforderungen: Skalierung schlägt Proof-of-Concept
Der schwierigste Teil beginnt nach der Erstinbetriebnahme: die Skalierung. Komponentenverfügbarkeit unter Sanktionsbedingungen, Qualitätssicherung in der Serienfertigung, Startinfrastruktur (inklusive neuer Träger wie Soyuz-5), der Aufbau eines Terminal-Ökosystems sowie Betrieb und Wartung einer Konstellation über viele Jahre sind Mammutaufgaben. Hinzu kommen Regulierungsfragen: ITU-Koordination, nationale Lizenzen, Interferenzmanagement und, im Exportfall, Compliance mit internationalen Vorgaben. Auch die Wirtschaftlichkeit steht auf dem Prüfstand: Starlink subventioniert Hardware teils quer und setzt auf globalen Absatz, während nationale Systeme ihren Business Case häufig aus Regierungs- und Industriekunden speisen. Für Russland dürfte die Frühphase stark behördlich und militärisch geprägt sein, bevor gegebenenfalls ein kommerzieller Massenmarkt adressiert wird.
Fazit: Ambition mit klaren Prüfsteinen
Die Ansage aus Moskau signalisiert, dass Russland die Bedeutung orbitaler Netze neu gewichtet und den Aufbau einer eigenen LEO-Infrastruktur politisch priorisiert. Technisch ist die Richtung plausibel, die Prototypen sind dokumentiert, die Fertigungs- und Startpfade zeichnen sich ab. Entscheidend wird, ob Roskosmos und die Industrie die Serientauglichkeit zügig erreichen, Terminalkosten senken und eine verlässliche Startkette etablieren. Gelingt das, könnte ein funktionsfähiger nationaler LEO-Dienst entstehen, der inländische Versorgungslücken schließt und kritische Kommunikation absichert. Scheitert die Skalierung, bleibt es bei Insellösungen. Die nächsten 12 bis 24 Monate – mit ersten Serienstarts und dem Hochlauf der Produktion – werden zeigen, ob aus dem „hohen Tempo“ ein belastbarer Betrieb wird.
Letzte Aktualisierung am 1.09.2025 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API. Alle hier angezeigten Preise und Verfügbarkeiten gelten zum angegebenen Zeitpunkt der Einbindung und können sich jederzeit ändern. Der Preis und die Verfügbarkeit, die zum Kaufzeitpunkt auf Amazon.de angezeigt werden, sind maßgeblich. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.
Quellen
- Reuters: Russia developing Starlink rival at ‘rapid pace,’ space chief says
- Bureau 1440 – Company site (EN)
- Aviation Week: Bureau 1440 poised to be Soyuz-5 launch customer
- Gunter’s Space Page: Rassvet-1 prototypes
- The Moscow Times: Russia to launch Starlink rival later this year