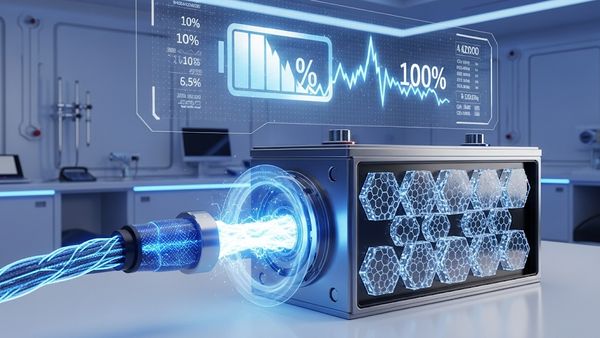Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am 23. September 2025 die Unterlassungsklage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen die Lidl-Plus-App abgewiesen. Nach Auffassung des 6. Zivilsenats ist „Preis“ im Sinne des deutschen und europäischen Rechts ein zu zahlender Geldbetrag – die Weitergabe personenbezogener Daten ist rechtlich kein Preis. Die Nutzung der App dürfe daher als „kostenlos“ bezeichnet werden; zugleich ließ das Gericht wegen grundsätzlicher Bedeutung die Revision zum Bundesgerichtshof (BGH) zu. Damit ist die Debatte, ob Rabatte gegen Daten ein Preis sind, rechtlich noch nicht beendet, politisch und gesellschaftlich ohnehin nicht.
Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte argumentiert, Lidl informiere Nutzer nicht deutlich genug darüber, dass exklusive Rabatte in der App nur im Gegenzug zur Preisgabe persönlicher Daten erhältlich sind. Der Verband kündigte nach der Entscheidung an, die Grundsatzfrage „Bezahlen mit Daten“ vor dem BGH klären zu lassen. Unabhängig vom konkreten Verfahren bleibt der Kernkonflikt bestehen: Wenn der wirtschaftliche Gegenwert der Daten nicht als Preis gilt, stößt das traditionelle Preisrecht an digitale Grenzen – die Informationspflichten und Transparenzstandards geraten in den Fokus.
Was genau fällt bei Lidl Plus an? Bereits bei der Registrierung sind E-Mail, Mobilnummer, Name, Geburtsdatum und Passwort Pflicht. In der Nutzung erfasst Lidl laut Datenschutzhinweisen u. a. die besuchte Filiale, eingelöste Coupons, Einkaufs- und Interaktionsdaten, teils auch Standort- und Gerätedaten. Diese Informationen werden für Personalisierung, Kampagnensteuerung und Auswertungen genutzt – ein datenökonomisches Modell, das branchenweit üblich ist. Die juristische Frage, ob daraus ein „Preis“ wird, hat das OLG Stuttgart verneint; die verbraucherrechtliche Frage, ob diese Gegenleistung verständlich, transparent und freiwillig ist, bleibt der Prüfmaßstab für die nächste Instanz.
Bemerkenswert ist die Dimension: Nach Konzernangaben nutzen weit über 100 Millionen Menschen die Lidl-Plus-App – die Konsequenzen eines Präzedenzurteils reichten daher über einen Einzelfall hinaus. Ein Sieg Lidls stärkt die Rechtsposition von Bonus- und Loyalty-Apps, die Rabatte als Anreiz für Datennutzung einsetzen; eine höchstrichterliche Korrektur könnte wiederum branchenweite Transparenz- und Hinweispflichten nachschärfen, etwa klarere „Daten-Gegenleistung“-Hinweise beim Onboarding, präzisere Opt-in-Texte und prominentere Widerspruchsmöglichkeiten. Für Handelsketten wäre das kein Verbot von Apps, aber ein Compliance-Upgrade mit Auswirkungen auf Konversionsraten und Kampagnenlogik.
Für Verbraucher bedeutet das Urteil kurzfristig: Rabatte bleiben in der Regel ohne Geldzahlung erhältlich, doch die eigene Datenspur hat ökonomischen Wert. Wer die App nutzt, sollte die Datenschutzhinweise lesen, granulare Einwilligungen prüfen, standortbezogene Berechtigungen im Smartphone beschränken und regelmäßig Coupons nur selektiv aktivieren. Mittel- bis langfristig entscheidet die BGH-Revision, ob es im deutschen Recht eine stärkere Gleichsetzung von Daten-Gegenleistung und Preisangabe geben wird. Bis dahin wird die öffentliche Kommunikation der Händler über „kostenlos“ versus „Rabatt gegen Daten“ unter der Beobachtung von Aufsichtsbehörden, Verbraucherschützern und Medien stehen. Dass das Stuttgarter Urteil die Revision zulässt, unterstreicht den Weg zu einer verbindlichen Leitentscheidung.
Transparenz bleibt dabei das Schlüsselwort. Schon heute formuliert Lidl in seinen Datenschutzdokumenten Zwecke, Rechtsgrundlagen und Widerspruchsrechte, inklusive Möglichkeiten zur Löschung und Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Beschwerde bei der Aufsicht. Genau diese Dokumente – und wie verständlich sie für Alltagsnutzer sind – werden mit darüber entscheiden, ob Gerichte künftig strengere Hinweise verlangen. Gleichzeitig zeigt die breite Berichterstattung, dass das Thema „Bezahlen mit Daten“ längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht nur Spezialisten beschäftigt.
Einordnung: Warum das Urteil wichtig ist
Das Stuttgarter Urteil liefert keine Absolution für Datensammeln, sondern eine juristische Klärung eines Begriffs: „Preis“ ist Geld. Alles Weitere – Informationspflichten, Einwilligungen, Transparenz, Datenminimierung – bleibt voll justiziabel. Für die Praxis im Handel heißt das: Wer mit persönlichen Daten arbeitet, sollte die Zweckbindung präzise formulieren, Dark Patterns vermeiden, Opt-ins sauber dokumentieren und verständliche Kurzinfos direkt im Flow der Registrierung bieten. Für Nutzer gilt: Informierte Entscheidungen treffen – und sich des tatsächlichen Gegenwerts der eigenen Daten bewusst sein. Dass der Fall Lidl Plus Signalwirkung für Loyalty-Programme anderer Ketten haben kann, betonen Branchenbeobachter schon seit Monaten.
„Kostenlos“ bleibt rechtlich vorerst „ohne Geld“, nicht „ohne Gegenleistung“. Der Preis in Daten ist kein Preis im Sinne des Preisrechts – noch nicht. Ob der BGH daraus neue Transparenzmaßstäbe für Bonus-Apps ableitet, wird zur Weichenstellung für die gesamte Branche. Bis dahin gilt: Wer spart, zahlt nicht mit Euro, aber gibt Wertvolles preis. Und genau dieser Wert verlangt Ehrlichkeit, Wahlfreiheit und Kontrolle.
Quellen
- LTO: OLG Stuttgart – Verbraucherschützer scheitern, Revision zugelassen (23.09.2025)
- Beck-aktuell: Urteil 6 UKl 2/25 – App darf „kostenlos“ heißen (23.09.2025)
- vzbv: Einordnung und Ankündigung der Revision (23.09.2025)
- t-online: Verbraucherzentrale verliert Klage zu Lidl-Plus-App (23.09.2025)
- Lidl Plus – Privacy Notice (Juli 2024, PDF)