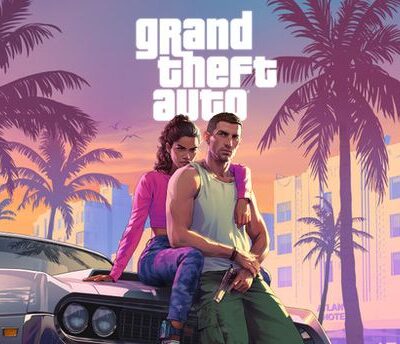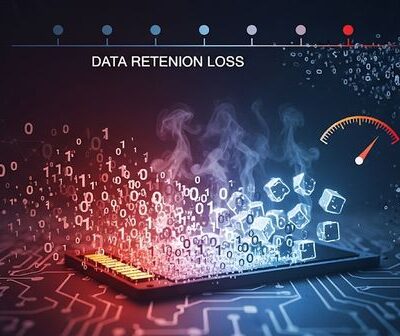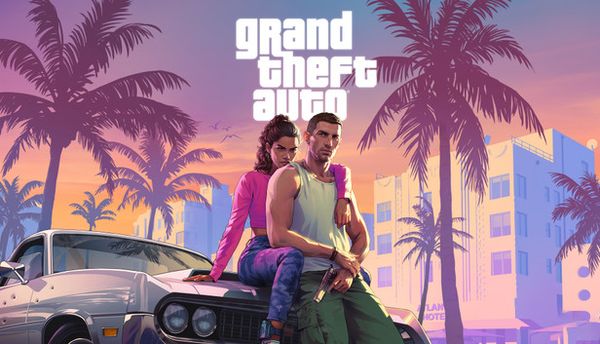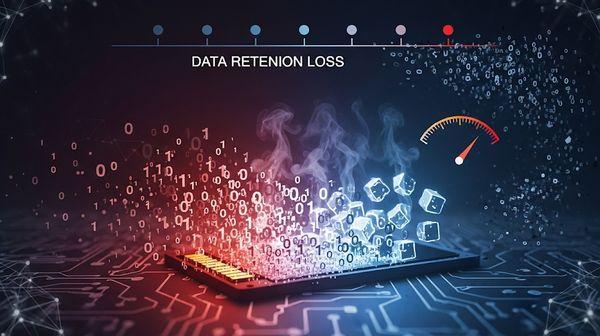Folgen für Handel, Preise und Tech
Ein 7:4-Urteil des Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) stellt die rechtliche Grundlage von Präsident Trumps breiter Zollpolitik infrage. Die Richter entschieden, dass der Präsident für die meisten unter dem Notstandsgesetz IEEPA verhängten Zölle keine Befugnis hatte. Die Abgaben bleiben jedoch bis zum 14. Oktober 2025 in Kraft, um eine Berufung vor dem Supreme Court zu ermöglichen.
Das Urteil im Kern
Die CAFC-Mehrheit bestätigte die Entscheidung des US-Handelsgerichts (CIT): Das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) erlaube zwar Sanktionen in Notlagen, aber keine pauschalen Importzölle. Damit sind Trumps „reciprocal“-Zölle und gesonderte „Trafficking“-Zölle (u. a. mit dem Kampf gegen Fentanyl begründet) rechtswidrig.
Wichtig: Zölle auf Stahl und Aluminium nach Section 232 (separater Rechtsrahmen) sind nicht betroffen.
Welche Zölle stehen auf der Kippe?
- „Reciprocal“-Zölle von 10 % bis 41 % auf Dutzende Länder, per Executive Order Ende Juli angekündigt und Anfang August in Kraft gesetzt. Diese Kerninstrumente der „Tarif-Gegenwehr“ treffen weite Teile des Welthandels.
- „Fentanyl/Trafficking“-Zölle gegen China, Kanada und Mexiko, die Trump im Februar auf IEEPA-Basis begründet hatte. Auch sie wurden vom Gericht kassiert.
Status bis 14. Oktober: Alle betroffenen IEEPA-Zölle bleiben vorerst erhoben; danach entscheidet voraussichtlich der Supreme Court über Reichweite und Grenzen präsidialer Zollmacht.
Direkte Auswirkungen für Verbraucher
Zusätzlich zum Rechtsstreit erhöht eine separate Maßnahme die Kosten: Die USA haben die De-minimis-Freigrenze von 800 US-Dollar für Kleinsendungen abgeschafft. Damit werden auch günstige Online-Bestellungen verzollt – mit teils erheblichen Abgabensätzen oder Pauschalen, mehr Papierkram und Verzögerungen bei Post- und Kuriersendungen.
Experten erwarten spürbare Preisaufschläge im Online-Handel und temporäre Lieferrisiken, weil Zollstellen und Logistik auf die neuen Prozesse umstellen müssen.
Was bedeutet das für Unternehmen?
Die gleichzeitige Unsicherheit durch das Urteil (Zölle rechtswidrig, aber weiter erhoben) und die Abschaffung von De-minimis belastet Planbarkeit, Margen und Cashflows. Viele Firmen müssen Preise neu kalkulieren, Lieferketten anpassen und zusätzliche Zolldaten liefern – vom Produktursprung bis zu detaillierten Warencodes.
Finanzmärkte reagierten bislang nur moderat; die größere Volatilität droht, falls der Supreme Court die Zölle kurzfristig kippt oder das Weiße Haus aggressive Alternativpfade wählt.
Politische Fronten
Trump weist die Entscheidung als „hochgradig parteiisch“ zurück und warnt, ein Ende der Zölle würde den USA schweren Schaden zufügen. Das Justizministerium strebt eine schnelle Prüfung durch den Supreme Court an.
Einordnung: Wie weit reicht IEEPA?
IEEPA wurde historisch für Sanktionen gegen Gegner und zur Einfrierung von Vermögenswerten genutzt, nicht für flächendeckende Importabgaben. Der CAFC hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass der Kongress damit eine Blankovollmacht für Zölle erteilen wollte.
Analysten rechnen damit, dass der Supreme Court – vor dem Hintergrund der Major-Questions-Doctrine – die Grenzen exekutiver Wirtschaftspolitik weiter schärfen könnte.
Tech- und Retail-Sektor besonders exponiert
Elektronik, Komponenten, IT-Zubehör und Consumer-Hardware sind traditionell importlastig – höhere Abgaben treffen diese Segmente zuerst. Parallel wird der Zollrahmen über Section 232 in einzelnen Industrien (z. B. Stahl/Aluminium) sogar ausgedehnt, was Vorleistungskosten für Bau, Maschinenbau, Automotive und Robotik weiter hebt.
Kurzchronik
- April 2025: Trump deklariert per IEEPA eine Handelsnotlage und kündigt „Reciprocal“-Zölle an.
- 28. Mai 2025: Das Handelsgericht (CIT) erklärt die IEEPA-Zölle für rechtswidrig.
- 7. August 2025: „Reciprocal“-Zölle treten in Kraft (je nach Land 10–41 %).
- Ende August 2025: Abschaffung der De-minimis-Freigrenze (800 US-$) für Kleinsendungen.
- 29./30. August 2025: CAFC bestätigt die Rechtswidrigkeit der IEEPA-Zölle, lässt Erhebung aber bis 14. Oktober zu.
Was Unternehmen jetzt pragmatisch tun können
- Zollklassifikationen prüfen (HTS-Codes, Ursprungsregeln), um Abgabensätze und Präferenzen korrekt zu ziehen.
- Landed-Cost-Modelle aktualisieren (inkl. Zoll, Gebühren, Logistik, Compliance-Kosten).
- Vertragsklauseln zu Zöllen, Incoterms und Preisgleitern nachschärfen.
- Alternativen wie Verzollung im Zolllager, Freizonen, Lieferanten-Dual-Sourcing evaluieren.
- Für Rechts- und Prozessfragen frühzeitig Zoll- und Außenhandelsexperten einbinden.
Quellen & weiterführende Links
- TechRepublic: Appeals Court Deals Major Blow to Trump’s Global Tariffs
- Reuters: Most Trump tariffs are not legal, US appeals court rules
- CAFC-Urteil (PDF): V.O.S. Selections, Inc. v. Trump
- Council on Foreign Relations: How Court Rulings Could Affect Trump’s Trade Policies
- AP: Duty-free no more – Ende der De-minimis-Freigrenze
- Washington Post (Kommentar): Folgen der De-minimis-Abschaffung
- Reuters: What the end of the de-minimis exemption means
- PBS NewsHour: What consumers can expect
- ABC News: Closure of the de-minimis loophole
- White House: Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates (31. Juli)
- White House: Reciprocal Tariffs & China-Verhandlungen (11. August)
- Reuters: 10–41 % „Reciprocal“-Zölle im Überblick
- Al Jazeera: Tariff wars & WTO-Kontext
- GMF: Legal-Policy-Einordnung zu neuen US-Zöllen
- TechRepublic (Hintergrund & Marktreaktionen)