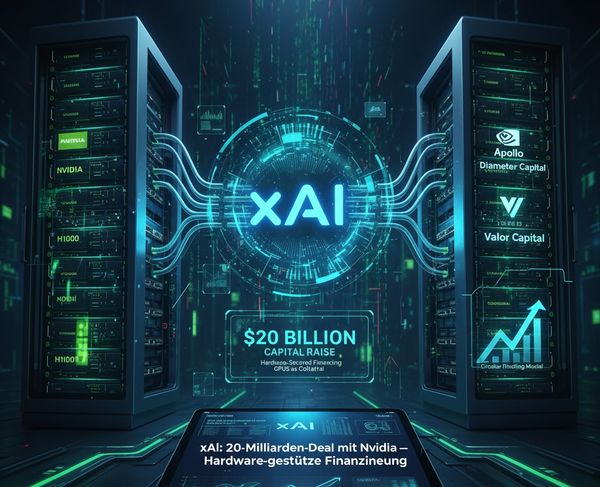Berlin – Kulturstaatsminister Wolfram Weimer plant, noch im Herbst ein Konzept für eine Digitalabgabe vorzulegen, das große Plattformbetreiber wie Google oder Meta zur Kasse bitten soll. Diese Maßnahme soll „faire Abgaben“ sicherstellen, die Medienvielfalt stärken und der zunehmenden Deutungsmacht von Big Tech entgegentreten. Doch Kritiker sehen darin weniger einen Fortschritt als einen möglichen Tiefpunkt der deutschen Politik: überzogene Steuerforderungen, wirtschaftliche Kollateralschäden und unklare Wirkungen.
Was genau will Weimer mit der Digitalabgabe?
Weimer spricht von einem sogenannten „Plattform-Soli“, der steuerrechtliche, kartellrechtliche und regulatorische Elemente enthalten wird. Die Idee orientiert sich an Österreich, wo große Plattformen seit 2020 fünf Prozent ihrer Werbeumsätze abführen müssen. Für Deutschland schlägt Weimer eine Abgabe von etwa zehn Prozent vor.
Weimer betont, dass Endverbraucher nicht direkt belastet werden sollen und sieht internationale Vorbilder als Beleg dafür, dass solche Abgaben möglich sind, ohne spürbare Preissteigerungen für den Einzelnen. Er erkannte zugleich die breite Rückendeckung in den Regierungsfraktionen von Union und SPD sowie bei den Grünen.
Kritikpunkte: Handelshemmnis, Innovationsrisiko und politische Überforderung
Ein zentraler Kritikpunkt kommt aus der digitalen Wirtschaft: Verbände wie der BVDW warnen, eine Digitalabgabe könne Innovation hemmen und die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen. Es bestehe die Gefahr, dass Deutschland sich mit Einzelmaßnahmen isoliert und damit handelspolitische Spannungen schafft – etwa wegen US-Konzernen.
Darüber hinaus gibt es Zweifel daran, ob das Konzept durchsetzbar ist: Wer genau betroffen sein wird (Werbeerlöse, Medieninhalte, Plattformtypen), wie hoch die Einnahmen sein werden und wie diese verteilt werden – etwa zur Stärkung der Medienvielfalt oder zur Förderung unabhängiger Plattformen – ist in vielen Details noch offen.
„Google zerschlagen“ – Weimers schärfste Ansage
Für besonderes Aufsehen sorgte Weimers jüngste Aussage, man müsse „Google zerschlagen“, wenn sich das Unternehmen weiterhin über nationale Gesetze hinwegsetze. Diese drastische Formulierung verdeutlicht die aggressive Tonlage seiner Digitalpolitik. Während er damit Zustimmung von jenen erhält, die die Dominanz von Big Tech brechen wollen, sehen andere darin ein gefährliches Signal: ein Minister, der mit populistischen Parolen operiert, statt tragfähige Lösungen zu erarbeiten. Juristen verweisen zudem darauf, dass eine Zerschlagung internationaler Konzerne weder rechtlich einfach noch politisch realistisch wäre – schon gar nicht auf nationaler Ebene innerhalb der EU.
Weimers Aussage steht somit sinnbildlich für den Kurs seiner Digitalpolitik: laut, symbolträchtig, aber wenig konkret. Kritiker bemängeln, dass solche Forderungen die Glaubwürdigkeit der Digitalstrategie beschädigen und Investoren abschrecken könnten. Was als „Digitalrevolution“ angekündigt war, droht zum politischen Showkampf zu werden.
Aus alten Fehlern nicht gelernt: Wie Regulierung und Abgaben schon die Gamingbranche bremsten
Die aktuelle Diskussion um Wolfram Weimers Digitalabgabe ruft Erinnerungen wach – denn ähnliche Fehlentwicklungen gab es in Deutschland bereits in der Gamingindustrie. Was heute droht, war dort schon Realität: Überregulierung, bürokratische Hürden und steuerliche Belastungen, die Innovation und Wettbewerbsfähigkeit massiv einschränkten.
Von Killerspielen bis Jugendschutz – ein Klima der Überregulierung
Seit den frühen 2000er-Jahren galt Deutschland als einer der restriktivsten Märkte für Videospiele in Europa. Nach tragischen Ereignissen wie dem Amoklauf von Erfurt 2002 setzte eine regelrechte politische Kampagne gegen sogenannte „Killerspiele“ ein. Entwicklerstudios litten unter verschärften Altersfreigaben, Verboten und einem gesellschaftlichen Klima, das Games pauschal kriminalisierte. Zahlreiche kleine Studios wanderten in dieser Zeit nach Österreich, Großbritannien oder Kanada ab, wo Entwicklungsförderung und gesellschaftliche Akzeptanz deutlich höher waren.
Steuern und Standortnachteile für Entwickler
Auch wirtschaftlich wurde die deutsche Gamingbranche über Jahre ausgebremst. Im Gegensatz zu Frankreich, Kanada oder Polen gab es lange Zeit keine nennenswerten Steuererleichterungen oder Förderprogramme für Entwickler. Erst seit 2020 wurde eine bundesweite Games-Förderung eingeführt – zu spät für viele Studios, die bereits aufgegeben oder abgewandert waren. Während andere Länder gezielt in kreative Industrien investierten, setzte Deutschland auf Regulierung, Verbote und Abgaben.
Das Resultat: Der Marktanteil deutscher Produktionen liegt heute bei unter fünf Prozent. Internationale Konzerne dominieren den hiesigen Markt, während lokale Entwickler kaum mithalten können. Diese Entwicklung zeigt, wie fehlgeleitete Politik langfristig Innovationskraft und Wirtschaftskraft schwächen kann.
Parallelen zur geplanten Digitalabgabe
Die Parallelen zu Weimers Digitalabgabe sind unübersehbar. Auch hier soll eine neue finanzielle Belastung „fairen Wettbewerb“ sichern – doch die Gefahr besteht, dass sie genau das Gegenteil bewirkt. Wie schon bei der Gamingindustrie droht eine Mischung aus Überbürokratisierung, falschen Anreizen und ideologisch motivierter Symbolpolitik. Unternehmen könnten in Länder mit günstigeren Rahmenbedingungen ausweichen, während Deutschland erneut als Hochrisikostandort für digitale Innovationen wahrgenommen wird.
Lehre aus der Vergangenheit
Die Geschichte der Gamingbranche in Deutschland zeigt, dass gut gemeinte politische Eingriffe oft unbeabsichtigte wirtschaftliche Schäden anrichten. Wenn Weimers Digitalabgabe wirklich die digitale Vielfalt fördern soll, darf sie nicht zu einer neuen Innovationsbremse werden. Statt Steuern und Regulierung braucht Deutschland eine offene, fördernde Digitalpolitik, die Kreativität und Unternehmertum stärkt – und nicht bestraft.
Quellen
- Killerspiele-Debatte und ihre Folgen für die Branche — Heise Online (2021)
- Deutschland als Standort für die Gamingbranche — Deutsche Welle (2023)
- Weimer sieht breite Rückendeckung für geplante Digitalabgabe — Investing.com (02.10.2025)