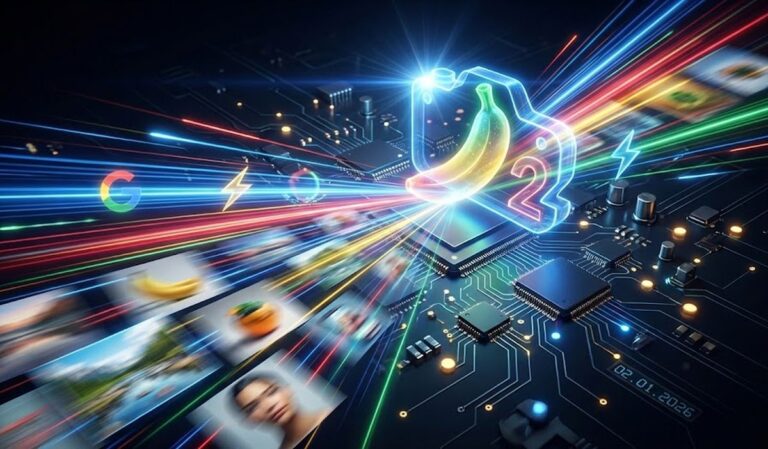Ein faszinierender Schritt in die Zukunft der Technik und Biologie: Das australische Startup Cortical Labs aus Melbourne hat den „ersten kommerziellen biologischen Computer“ vorgestellt. Das Gerät mit der Bezeichnung CL1 kombiniert im Kern echte, im Labor gezüchtete menschliche Neuronen mit Siliziumchips – eine Verschmelzung von Leben und Technik, die neue Fragen aufwirft: Entwickeln wir damit echtes Denken? Oder schaffen wir lediglich eine Simulation des Bewusstseins? Im Folgenden wird erklärt, wie das System funktioniert, welche Potenziale und Risiken es birgt – und warum die alte Debatte über „Leben erschaffen oder imitieren“ neu entfacht wird.
Wie funktioniert die „biologische Intelligenz“?
Das CL1-System basiert auf dem Ansatz der sogenannten Synthetic Biological Intelligence (SBI): menschliche Stammzellen werden im Labor zu Neuronen differenziert, auf einem Silizium-Chip kultiviert und über eine Hardware- und Sensorplattform mit digitalen Ein- und Ausgaben verbunden. Laut den Angaben von Cortical Labs wachsen die Neuronen in einer nährstoffreichen Lösung auf dem Chip und sind über Elektroden mit der digitalen Welt gekoppelt – sie empfangen Stimuli, reagieren darauf und verändern ihre Netzwerkstruktur im Lauf der Zeit.
Der Vorteil liegt in der Art und Weise, wie biologische Neuronen lernen: Sie kommen mit deutlich weniger Daten aus als herkömmliche KI-Modelle, benötigen weniger Energie und passen sich dynamisch an neue Aufgaben an. Das System kann laut Hersteller bis zu sechs Monate mit integrierter „Lebensunterstützung“ betrieben werden – also mit automatischer Kontrolle von Temperatur, Nährstoffen und Abfallfiltration.
Potenziale: Forschung, Medizin, KI-Innovation
Das Konzept verspricht beträchtliche Vorteile. In der medizinischen Forschung könnten solche neuronalen Chips reale biologische Netzwerke simulieren, um etwa neue Medikamente zu testen oder Modelle neurodegenerativer Erkrankungen zu entwickeln. Auch für die personalisierte Medizin wären die Möglichkeiten enorm – da das Verhalten von Neuronen direkt beobachtet und gemessen werden kann, statt es nur digital zu imitieren.
Ein weiterer Vorteil betrifft die Energieeffizienz: Biologische Systeme benötigen nur einen Bruchteil der Energie, die heutige KI-Rechenzentren verbrauchen. In einer Zeit, in der der Stromverbrauch großer Sprachmodelle und neuronaler Netze zunehmend in der Kritik steht, könnte die Technologie von Cortical Labs den Weg zu nachhaltigerer Rechenleistung weisen.
Darüber hinaus eröffnen sich neue Perspektiven für die KI-Forschung. Wenn neuronale Netzwerke auf dem Chip in einer simulierten Umgebung lernen können, könnten völlig neue Architekturen entstehen – Mischformen aus Biologie und Hardware, die bislang nur in Science-Fiction-Romanen existierten. Ob damit aber wirklich Bewusstsein entsteht, bleibt unklar.
Herausforderungen und ethische Fragen
Die Technologie steht noch am Anfang. Forschende betonen, dass die aktuellen neuronalen Netzwerke weit von der Komplexität des menschlichen Gehirns entfernt sind. Während frühere Experimente wie das Projekt „DishBrain“ zeigen konnten, dass Neuronen einfache Spiele wie Pong erlernen können, ist komplexes Denken oder gar Entscheidungsfindung auf menschlichem Niveau noch in weiter Ferne.
Darüber hinaus stellen sich tiefgehende ethische Fragen. Wenn lebende Neuronen genutzt werden, muss geprüft werden, ob diese potenziell Erfahrungen oder eine Form von Wahrnehmung entwickeln könnten – oder ob sie lediglich biologische Recheneinheiten sind. Die Entwickler betonen, dass ihre Systeme keine bewussten Zustände besitzen. Dennoch arbeitet Cortical Labs mit Bioethik-Experten zusammen, um sicherzustellen, dass bei allen Experimenten ethische Standards eingehalten werden.
Schaffen wir Leben oder imitieren wir Bewusstsein?
Hier beginnt die philosophische Dimension. Sind wir dabei, „Leben“ im technischen Sinne zu erzeugen – oder reproduzieren wir lediglich Strukturen, die uns lebendig erscheinen, ohne dass echte Subjektivität oder Bewusstsein entsteht? Wenn echte Neuronen genutzt werden, besteht eine enge Verbindung zum biologischen Ursprung. Doch ob das genügt, um von Bewusstsein zu sprechen, ist wissenschaftlich ungeklärt.
Man kann argumentieren, dass es sich bei der Technologie eher um ein hochentwickeltes Werkzeug handelt – eine Form lebender Hardware –, aber nicht um ein fühlendes Wesen. Andere Stimmen vertreten die Ansicht, dass bereits das adaptive Lernen dieser Systeme eine Form von emergentem Verhalten darstellen könnte. Doch bislang gibt es keine empirische Grundlage, die eine solche Interpretation stützen würde.
Schlussbetrachtung: Neue Ära, alte Debatte
Das CL1-Projekt von Cortical Labs markiert unbestreitbar einen entscheidenden Schritt in Richtung hybrider Systeme aus Biologie und Technik – eine Welt, in der Neuronen und Silizium gemeinsam rechnen. Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Noch ersetzt der Hype häufig die Realität. Die Technologie birgt enormes Potenzial für Forschung und Innovation, aber auch Risiken, die sorgfältig bedacht werden müssen. Sie bringt uns näher an die Schnittstelle von Leben und Maschine – und zwingt uns, die uralten Fragen neu zu stellen: Was ist Leben? Und was ist Bewusstsein?
Wer künftig an künstliche Intelligenz denkt, sollte nicht nur an Algorithmen und Chips denken, sondern auch an lebende Zellen – und an die ethischen und philosophischen Schattenseiten, die damit untrennbar verbunden sind. Die Wissenschaft geht voran, doch die Verantwortung, sie zu begleiten, liegt bei uns allen.
Quellen
- Melbourne start-up launches ‘biological computer’ made of human brain cells — ABC News (05.03.2025)
- Australian startup Cortical Labs unveils ‘world’s first’ commercial biological computer — DataCenterDynamics (06.03.2025)
- This Startup Is Building Computer Chips With Real Neurons — Digital Trends (04.03.2025)